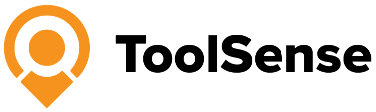Prüfungen digitalisieren und rechtssicher dokumentieren mit ToolSense
Wer kennt es nicht: Stapel von Papierprotokollen, die sich türmen, während Sie versuchen, Ihre elektrischen Anlagen zu prüfen? Stellen Sie sich vor, diese Prozesse wären digital, effizient und vollkommen rechtssicher. Mit ToolSense wird genau das möglich.



Das Thema kurz und kompakt
- Prüfprotokolle nach DGUV-Vorschrift 3 (früher BGV A3) belegen die Sicherheit elektrischer Betriebsmittel. Sie dienen dem Nachweis von Prüfungen gegenüber der Unfallversicherung im Schadensfall.
- Die Prüfung muss bei Neuanschaffung, Reparatur und in regelmäßigen Abständen durchgeführt werden. Dabei gilt eine maximale Frist von vier Jahren für ortsfeste und zwei Jahren für ortsveränderliche Geräte und Betriebsmittel.
- Elektrische Betriebsmittel dürfen nach DGUV-Vorschrift 3 nur von einer Elektrofachkraft mit spezieller Qualifikation oder unter deren Anleitung geprüft werden.
- Mit einer Elektroprüfungssoftware wie ToolSense können Sie die Überwachung, Wartung und Dokumentation einfach digitalisieren und von den vielen Vorteilen digitaler Elektroprüfungen profitieren.

Was sind Prüfprotokolle für elektrische Anlagen gemäß DGUV-Vorschrift 3?
Laut der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) ist es die Pflicht eines jeden Arbeitgebers, die Sicherheit der elektrischen Anlagen im Betrieb zu gewährleisten. Dies dient dazu, Unfällen vorzubeugen und Mitarbeiter zu schützen. Als Teil der Wartung und Instandhaltung elektrischer Anlagen und Maschinen ist es daher zwingend notwendig, diese in regelmäßigen Abständen von einer qualifizierten Elektrofachkraft prüfen zu lassen. Prüfprotokolle enthalten Aufzeichnungen über den Verlauf und die Ergebnisse der DGUV 3 Prüfung, in Form von Ist- und Soll-Ergebnissen, und entsprechende Lösungsvorschläge.
Ein detailliertes Protokoll schafft zudem Rechtssicherheit: So belegt es, dass die Prüfung elektrischer Anlagen ordnungsgemäß ausgeführt wurde. Im Fall eines Schadens oder Unfalls kann dies den Arbeitgeber entlasten, der ansonsten schlimmstenfalls hohe Kosten und strafrechtliche Folgen zu tragen hätte.
Welche Unternehmen müssen Prüfprotokolle erstellen lassen?
Generell ist jedes Unternehmen zur Prüfung verpflichtet, bei dem elektrische Geräte, Maschinen und Anlagen zum Einsatz kommen – also auch solche, deren Tätigkeiten primär im Büro stattfinden. Kaffeemaschinen und Mikrowellen für die Büroküche müssen folglich ebenso geprüft werden wie Hochspannungsanlagen oder Schaltkästen. Dabei muss jedes bestehende oder neu angeschaffte Gerät vor der ersten Inbetriebnahme und danach in regelmäßigen Abständen geprüft werden, um dessen Sicherheit und Funktionsfähigkeit sicherzustellen. Die geltenden Normen unterscheiden zwischen ortsfesten und ortsveränderlichen Geräten, für die jeweils unterschiedliche Prüfungsvorschriften gelten.
Schließen Sie sich 700+ Unternehmen an, die mit ToolSense arbeiten



Rechtliche Grundlagen für die Prüfung nach DGUV V3 (ehemals BGV A3)
Rechtsgrundlage dafür sind die Vorschriften der DGUV und die Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), die Arbeitgebern verbindliche Richtlinien zur Unfallverhütung vorgeben. So ist der Arbeitgeber verpflichtet, durch Dienstvorschriften und regelmäßige Kontrollen der verwendeten Anlagen für eine sichere Arbeitsumgebung zu sorgen. Zu diesem Zweck legt DGUV-Vorschrift 3 fest, dass nur eine Fachkraft zur Installation, Änderung oder Wartung von Elektrogeräten und -anlagen befugt ist. Dies soll sicherstellen, dass die entsprechenden Maßnahmen fachlich korrekt ausgeführt werden und bei der Nutzung der Anlage keine Gefahr für den Benutzer besteht.
Die Prüfpflicht selbst ergibt sich aus § 5 der DGUV-Vorschrift 3, die Prüfungen durch eine Fachkraft oder unter deren Anleitung vorschreibt, wenn:
- ein Gerät neu angeschafft wurde oder
- ein Bestandsgerät instand gesetzt wurde und wieder in Betrieb genommen werden soll sowie
- in regelmäßigen Abständen, die die rechtzeitige Feststellung üblicher Mängel ermöglichen.
DGUV V3 Prüfprotokoll Vorlage Download kostenlos
Mit dem kostenlosen Prüfprotokoll von ToolSense können Sie fachgerecht die Prüfung Ihrer Geräte und Betriebsmittel planen & durchführen.
Warum müssen Prüfungen rechtssicher dokumentiert werden?
Das Prüfprotokoll dient dabei als Nachweis, der belegt, dass eine ordnungsgemäße DGUV Elektroprüfung stattgefunden hat und ohne Beanstandung abgeschlossen wurde. Dadurch sind Arbeitgeber im Zweifelsfall rechtlich auf der sicheren Seite: Kommt ein Arbeitnehmer oder das Inventar durch eine defekte elektrische Anlage zu Schaden, können sie anhand des Prüfberichts beweisen, dass sie ihre Sorgfaltspflicht erfüllt haben.
Im Schadensfall kommt dem Prüfprotokoll somit eine tragende Bedeutung zu. Um durch Brände zerstörtes Inventar von der Versicherung ersetzt zu bekommen, muss Fahrlässigkeit ausgeschlossen werden können.
Bei Personenschäden hingegen können Forderungen des Arbeitnehmers bei der zuständigen Berufsgenossenschaft geltend gemacht werden. Diese kommt für die Kosten der Behandlung der Folgen von Arbeitsunfällen auf. Ferner zahlt sie dem Arbeitnehmer im Falle einer vorübergehenden oder dauerhaften Arbeitsunfähigkeit durch einen Unfall eine Invalidenrente. Wurde eine schadhafte Anlage hingegen nicht regelmäßig sachgemäß überprüft, hat der Arbeitgeber fahrlässig gehandelt. Bei Feststellung einer solchen Fahrlässigkeit muss er für Behandlungskosten und Kompensation aus eigener Tasche aufkommen. Zudem kann der Arbeitnehmer in diesem Fall Schadenersatzansprüche geltend machen.
Die DIN VDE-Normen: Leitfaden zur Durchführung von Prüfungen
Umfang und Inhalt eines Prüfprotokolls sind, je nach Art der Prüfung und Beschaffenheit der Anlage, in einer Reihe verschiedener DIN-Normen geregelt.
Prüfung ortsfester Anlagen und Betriebsmittel
Für die Prüfung ortsfester Anlagen sind dies insbesondere die DIN VDE 0100-600 bei Neuinstallationen und Änderungen sowie die DIN VDE 0105-100 bei Wiederholungsprüfungen. Diese beiden Normen sind in den wesentlichen Punkten ähnlich; sie zielen darauf ab, dass Betriebsmittel sicher verwendbar sind. Zu diesem Zweck schreiben sie unter anderem vor, dass Schutzmaßnahmen gegen Stromschläge vorhanden sein und Kabel und Leitungen dem Betriebsstrom der Anlage standhalten müssen, an der sie verbaut sind. Ferner liefern sie eine Empfehlung, wie das Messverfahren bei Überprüfungen nach VDE-Norm abzulaufen hat. Dabei ist diese jedoch nicht absolut verbindlich. Können durch ein anderes Verfahren gleichwertige Ergebnisse erzielt werden, spricht nichts dagegen, stattdessen jenes zu verwenden.
Prüfung ortsveränderlicher Geräte und Betriebsmittel
Bei ortsveränderlichen Betriebsmitteln wie Verlängerungskabeln oder Elektrokleingeräten greift stattdessen die DIN VDE 0701-0702. Deren Anwendungsbereich erstreckt sich auf sämtliche steckbaren elektrischen Betriebsmittel; somit ist sie auf alle Geräte anwendbar, deren DGUV Elektroprüfung nicht durch eine separate Norm geregelt ist. Sie legt fest, wie Prüfungen nach der Reparatur bzw. bei der regelmäßigen Überprüfung durchzuführen sind. Anders als bei ortsfesten Anlagen ist bei ortsveränderlichen Geräten eine Abnahme nach Installation nicht notwendig – die Funktionstüchtigkeit und Sicherheit wird bei Neuware vom Hersteller garantiert. Ebenso können kleinere Wartungsarbeiten bedenkenlos selbst ausgeführt werden, wenn sie vom Hersteller vorgesehen oder alltagsüblich sind.
Prüffristen und besondere Umstände
Die DIN-Normen legen ebenfalls fest, wann elektrische Anlagen und Betriebsmittel spätestens zu prüfen sind – nicht jedoch, welche exakten Abstände unter welchen Umständen eingehalten werden müssen. So ist für ortsfeste Anlagen vorgeschrieben, dass zwischen zwei DGUV 3 Prüfungen maximal vier Jahre liegen dürfen.
Bei ortsveränderlichen Anlagen hingegen muss innerhalb von zwei Jahren die nächste Prüfung erfolgen. Die genauen Fristen für die Überprüfung elektrischer Anlagen nach DGUV-Vorschrift 3 ergeben sich jedoch aus der BetrSichV und den Umgebungsbedingungen.
Beispiele für Prüfintervalle
So müssen Geräte, die regelmäßig unter Bedingungen genutzt werden, die Verschleiß begünstigen, öfter geprüft werden als solche, die ständig in einem klimatisierten Büro verwendet werden. Daher kann beispielsweise bei elektrischem Werkzeug, das auf Baustellen zum Einsatz kommt, eine Wiederholungsprüfung bereits nach drei Monaten erforderlich werden, um die Sicherheit zu gewährleisten.
Aus diesem Grund entscheidet die mit der Prüfung betraute Elektrofachkraft während der Prüfung, ob das bisherige Prüfungsintervall weiterhin angemessen ist. Wurde eine Anlage beanstandet, darf sie bis zur Neuprüfung nach Behebung des Mangels nicht verwendet werden.
Zur Prüfung befähigte Personen
Prüfungen elektrischer Betriebsmittel dürfen generell nur von einer entsprechend qualifizierten Elektrofachkraft oder unter deren Anleitung durchgeführt werden. Eine solche Elektrofachkraft ist in der DIN EN 50110-1:2008-08-01 definiert als eine Person, die über eine fachliche Ausbildung sowie entsprechende Kenntnisse und Berufserfahrung verfügt. Dabei kann es sich um einen Elektriker, Elektroingenieur oder spezialisierten Gutachter handeln. Wichtig ist jedoch, dass für die fachgerechte Prüfung elektrischer Anlagen in der Regel eine zusätzliche Fortbildung und langjährige Berufserfahrung notwendig ist.
Soll die Wiederholungsprüfung von Mitarbeitern im eigenen Hause durchgeführt werden, müssen diese unbedingt zuvor angeleitet worden sein; auch dies ist von der zuständigen Elektrofachkraft zu dokumentieren. Zudem sollte ihnen eine schriftliche, möglichst detaillierte Betriebsanweisung zur Hand gegeben werden, die durch die einzelnen Prüfschritte führt.

DGUV Elektroprüfung: Ablauf der Prüfung nach DIN-Norm
DGUV-V3-Prüfung-Ablauf: Der Ablauf einer Prüfung nach DGUV-Vorschrift 3 lässt sich grob in drei Abschnitte unterteilen:
- die Besichtigung,
- die Messung
- und die Funktionsprüfung.
Je nach Beschaffenheit der Anlage und Art der Prüfung sind die einzelnen Prüfschritte in den DIN-Normen VDE 0100-600, VDE 0105-100 und VDE 0701-0702 vorgeschrieben und müssen, falls zutreffend, vollständig und gewissenhaft ausgeführt werden.
Besichtigung
Bei der Sichtung einer Anlage liegt das Hauptaugenmerk auf Mängeln, die von außen sichtbar sind, ohne das Gerät zerlegen zu müssen. Die Elektrofachkraft kontrolliert dabei, ob Schäden am Gehäuse, Abnutzung und Verschmutzung, zum Beispiel von Lüftern, die Sicherheit des Geräts beeinträchtigen. Wurden in Eigenregie Eingriffe vorgenommen, müssen auch diese dokumentiert werden, um eine Gefährdung auszuschließen.
Zum Vergleich zieht die Elektrofachkraft bei der Besichtigung die Unterlagen zur Anlage heran; daher ist es von großer Bedeutung, vergangene Prüfprotokolle aufzubewahren und für die Prüfung bereitzuhalten.
Im Fall einer ortsfesten elektrischen Anlage erfolgt im Rahmen der Prüfung gemäß DIN VDE 0105 eine Bestandsaufnahme. In deren Rahmen kontrolliert der Prüfer anhand von Grundrissen und Übersichtsschaltplänen den ordnungsgemäßen Zustand der elektrischen Betriebsmittel.
Schließen Sie sich 700+ Unternehmen an, die mit ToolSense arbeiten



VDE Messung
Auf die Besichtigung und Bestandsaufnahme folgt eine Reihe Messungen. So muss geprüft werden, ob die Schutzmaßnahmen der Anlage ordnungsgemäß funktionieren. Mit einem geeigneten Messgerät misst die Elektrofachkraft unter anderem die Durchlässigkeit der Schutzleiter und die Wirksamkeit der Isolation in Form des Isolationswiderstands.
Funktionsprüfung
Wurden die Besichtigung und sämtliche Messungen ohne nennenswerte Beanstandungen abgeschlossen, folgt eine Funktionsprüfung. Dabei testet die prüfende Fachkraft sämtliche Funktionen des Prüflings. Der Fokus dieser Untersuchung liegt auf Auffälligkeiten, die beim Betrieb der Anlage auftreten. Treten beim Betrieb Rauch, Rütteln, Geräusche oder eine auffällige Hitzeentwicklung auf, kann dies Grund für eine Beanstandung sein.
DGUV V3 Prüfprotokoll Download kostenlos
Mit dem kostenlosen Prüfprotokoll von ToolSense können Sie fachgerecht die Prüfung Ihrer Geräte und Betriebsmittel planen & durchführen.

Aufbau von Prüfprotokollen
Das resultierende Prüfprotokoll fasst die wesentlichen Erkenntnisse des Prüfverfahrens zusammen. Um eine eindeutige Identifizierung und Zuordnung zu ermöglichen, müssen in jedem Protokoll zudem:
- Angaben zu den Prüfschritten und Prüfergebnissen,
- Auftraggeber und Auftragnehmer,
- Standort und Datum,
- ausführende Elektrofachkraft,
- verwendetes Messgerät,
- sowie die Rechtsgrundlage der Prüfung aufgeführt sein.
Der Prüfling wird im Protokoll anhand von Hersteller, Typbezeichnung und Gerätenummer identifiziert.
Für die einzelnen Prüfpunkte ist die Form einer Checkliste (E-Check-Prüfprotokoll) geläufig; diese folgt dem Ablauf des Prüfverfahrens und ermöglicht durch Beantwortung der einzelnen Fragen eine übersichtliche Dokumentation des Ablaufs der Prüfung und möglicher Auffälligkeiten. Zusätzlich ist es üblich, dass Prüfprotokolle eine Einschätzung über die Schwere der vorgefundenen Mängel in Form eines abschließenden Mängelberichts beinhalten. Diese liefert wertvolle Empfehlungen darüber, ob eine Instandsetzung sich lohnt bzw. überhaupt noch möglich ist.
Abschließend muss das Prüfprotokoll sowohl vom Prüfer als auch vom Auftraggeber quittiert werden, um als Beweisurkunde verwendbar zu sein.

Unkomplizierte Elektroprüfung für Ihr Unternehmen – Das sind die Vorteile mit ToolSense
Excel-Tabellen haben ausgedient! Mit einer Elektroprüfung-Software wie ToolSense können Sie die Überwachung, Wartung und Dokumentation einfach digitalisieren und von den vielen Vorteilen digitaler Elektroprüfungen profitieren.
Stets auf dem aktuellen Stand bleiben mit automatischen Erinnerungen
Die Überprüfung von elektrischen Systemen kann komplex sein, besonders in Firmen mit zahlreichen Geräten. ToolSense stellt eine klare, vollständige Auflistung aller Betriebsmittel zur Verfügung, durch die Angestellte rasch einen weitreichenden Einblick gewinnen. So bleiben wichtige Testtermine stets im Blick. Um sicherzustellen, dass keine elektrische Inspektion ausgelassen wird, sendet die Software automatisch Erinnerungen in festgelegten Abständen.
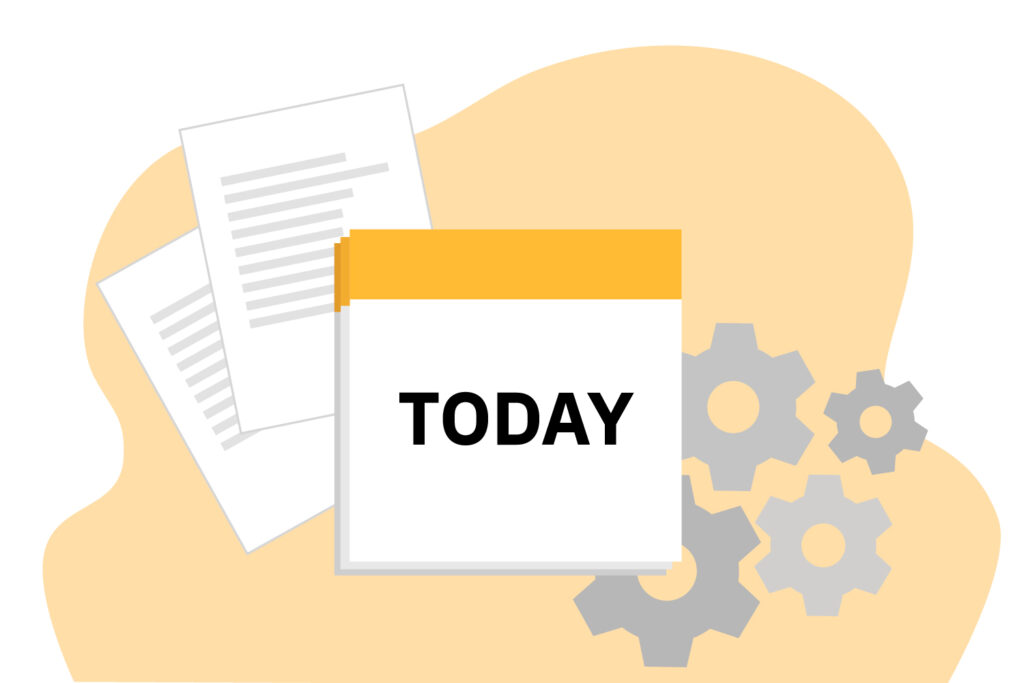
Arbeitssicherheit aller Mitarbeiter gewährleisten
Die Gewährleistung der Sicherheit aller Angestellten beim Umgang mit Maschinen und elektrischen Geräten steht an erster Stelle. Gemäß der DGUV Vorschrift 3 ist daher alle 24 Monate eine Elektroprüfung erforderlich, vorausgesetzt, die Fehlerquote liegt unter 2,0. Um die bevorstehenden Überprüfungstermine im Auge zu behalten, unterstützt eine Softwarelösung mit nützlichen Checklisten für die jährlichen Elektroinspektionen.

Zeit und Kosten sparen
Abhängig von der Anzahl der Betriebsmittel, die elektrischen Prüfungen unterliegen, kann für Unternehmen ein erheblicher zeitlicher und finanzieller Aufwand entstehen. ToolSense ermöglicht es, diesen Aufwand zu reduzieren, indem der Prozess der Elektroprüfung gemäß DGUV V3 digitalisiert und teilweise automatisiert wird. Effiziente Workflows und verbesserte Arbeitsprozesse tragen dazu bei, den Aufwand für die Elektroinspektionen an Maschinen deutlich zu senken.

Einfache Übermittlung und Speicherung der Prüfberichte
Prüfdokumentationen sind unerlässlich, um die durchgeführten Elektroinspektionen nachvollziehen zu können. In der ToolSense Softwarelösung besteht die Möglichkeit, diese direkt nach der Prüfung im Lebenszyklus-Ordner des betreffenden Geräts zu speichern, wodurch sie jederzeit abgerufen werden können.

Mängelbewertung und -dokumentation
Falls bei einer Elektroprüfung im Betrieb Defekte festgestellt werden, ist es möglich, diese zusammen mit den Prüfprotokollen im Lebenszyklusordner der jeweiligen Maschine zu hinterlegen. Dies ermöglicht Elektrikern und Fachkräften einen unkomplizierten Zugang zu den wesentlichen Informationen und erlaubt die schnelle Behebung der entdeckten Mängel. Dadurch wird sowohl die Arbeitssicherheit als auch die Betriebsbereitschaft der Geräte zügig wiederhergestellt.

Arbeitsprozesse mit smarten Workflows optimieren
Effiziente Arbeitsabläufe sind entscheidend, um in Unternehmen Zeit und Kosten bei der Durchführung von Elektroprüfungen zu reduzieren. Auch in diesem Bereich unterstützt die Elektroprüfungs-Software bei der Optimierung der Abläufe. Dies geschieht durch das Erstellen direkter Arbeitsaufträge in der Software, die einem Mitarbeiter zugeteilt und von ihm bearbeitet werden. Verantwortlichkeiten und Arbeitsschritte sind dadurch jederzeit klar erkennbar und auch nach der Fertigstellung des Auftrags einsehbar.
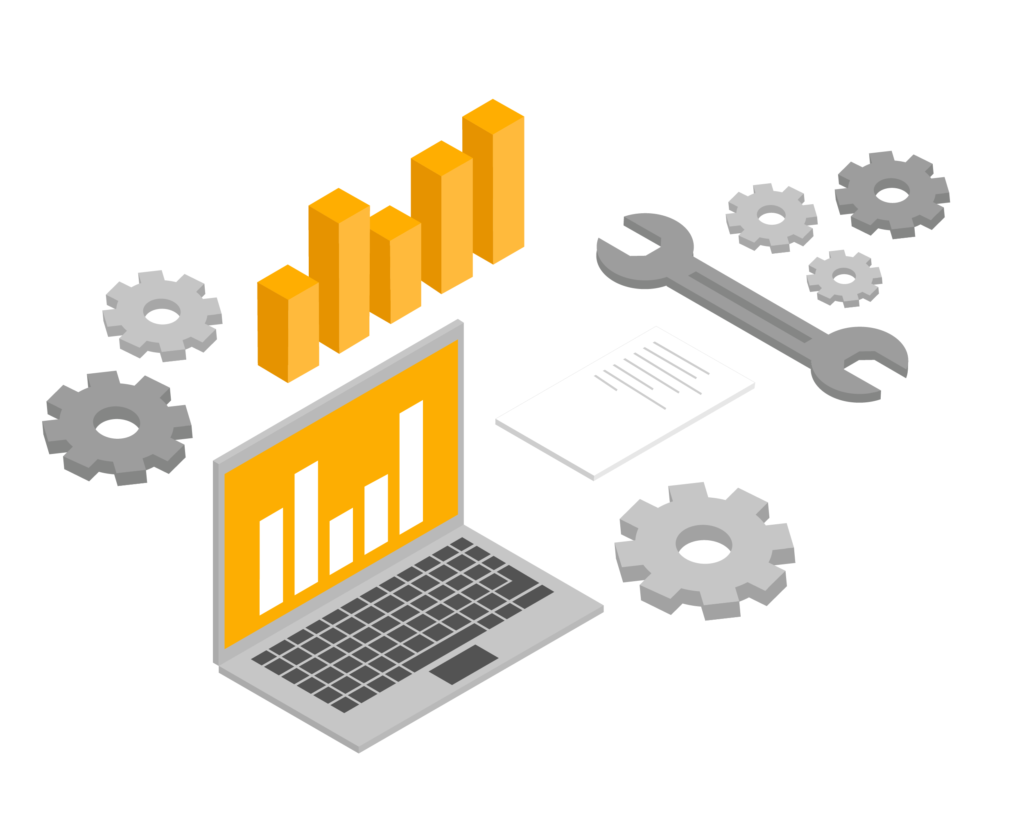
Fazit: Prüfprotokolle als Nachweis zur Erfüllung der Sorgfaltspflicht
Das Prüfprotokoll stellt eine der wichtigsten Beweisurkunden für Betriebe dar, in denen elektrische Anlagen und Betriebsmittel zum Einsatz kommen. Der Arbeitgeber hat gemäß Vorschrift der DGUV eine Sorgfaltspflicht zu erfüllen: Er hat dafür Sorge zu tragen, dass von elektrischen Anlagen im Betrieb keine Gefahr für den Benutzer ausgeht. Sind Prüfungen ordnungsgemäß und regelmäßig durchgeführt und hinreichend dokumentiert worden, kann dies im Schadensfall kostspielige Konsequenzen vermeiden.
Dazu ist es zwingend erforderlich, die Prüfung von einer kompetenten Elektrofachkraft mit zusätzlicher Zertifikation für Prüfungen nach der korrekten DIN-Norm durchführen zu lassen. Wird eine Anlage beanstandet, ist deren Nutzung unverzüglich zu unterbinden – die Sicherheit ist in diesem Fall nicht länger gewährleistet.
Mit ToolSense gehören all diese Probleme der vergangenheit an. Wir haben eine einfache Lösung für komplexe Prüfungen: Entdecken Sie unsere benutzerfreundliche Software für Elektroprüfungen.
Noch nicht überzeugt? Jetzt digitale Tour starten
FAQ
Ein Prüfprotokoll dokumentiert die Prüfung elektrischer Betriebsmittel durch eine qualifizierte Fachkraft. Es stellt somit eine wichtige Beweisurkunde für den Arbeitgeber dar, die den einwandfreien Zustand sämtlicher verwendeter Anlagen belegt.
Damit ein Prüfprotokoll seine Nachweisfunktion erfüllen kann, muss es die ausführende Elektrofachkraft, das verwendete Prüfgerät und die gesetzliche Grundlage für die Prüfung ausweisen. Zudem muss jedes geprüfte Gerät anhand von Hersteller, Typbezeichnung und Gerätenummer eindeutig zu identifizieren sein. Die Messdaten und deren Auswertung müssen in geordneter, übersichtlicher Form dokumentiert werden.
Generell sind sich die Protokolle zu den verschiedenen DIN-Normen aufgrund der Anforderungen und allgemeinen Konventionen sehr ähnlich – eine vom Gesetzgeber vorgeschriebene Form existiert jedoch nicht. Daher ist es umso wichtiger, selbst auf eine einheitliche Protokollführung zu achten. Es bietet sich zu diesem Zweck an, entweder eigene Muster zu erstellen oder professionelle Vordrucke zu verwenden. Letztere sind hier als DGUV-V3-Prüfprotokolle kostenlos zum Download als Excel-Datei verfügbar.
Die Ausfertigung eines ordnungsgemäßen Prüfprotokolls dient der Rechtssicherheit. Sollte es zu einem Unfall- oder Schadenereignis kommen, kann der Arbeitgeber damit nachweisen, dass eine Prüfung stattgefunden und keine Mängel an der Anlage aufgedeckt hat. Dies hilft dabei, Eigenverschulden oder Fahrlässigkeit auszuschließen und Ansprüche bei der zuständigen Versicherung durchzusetzen.
Im Fall privater Geräte ist die Zertifikation des Herstellers in der Regel ausreichend, da die Vorschriften der DGUV nur für Arbeitsunfälle gelten. Dennoch ist eine Prüfung bei Geräten zu empfehlen, die selbst repariert wurden oder von denen potenziell eine Brandgefahr ausgeht. Umgekehrt sollten Unternehmen es ihren Angestellten nicht erlauben, eigene Elektrogeräte mitzubringen – schlimmstenfalls erlischt im Schadensfall der Haftungsanspruch, wenn ein schadhaftes Privatgerät Verletzungen oder einen Brand verursacht.